3. Februar 2008 | Welt am Sonntag
Sie hatten keine Chance, aber sie nutzten sie
(Manuskriptfassung)
Mojtaba Sadinam hat wirklich Glück gehabt. Als er achtjährig als Flüchtling aus dem Iran nach Deutschland kam, da hat man ihm gleich einen Sprachkurs verordnet. Jetzt ist er 22 Jahre alt und studiert an einer privaten Hochschule Betriebswirtschaft, mit freundlicher Unterstützung der Vodafone-Stiftung. Der adrette junge Mann wohnt in Koblenz in einer netten Vorstadt-Wohnung mit seiner Freundin zusammen, einer Deutschen. Es sieht gut aus für ihn. Wirklich gut. Man könnte fast auf die Idee kommen, Mojtaba Sadinam sei ein Paradebeispiel für eine gelungene Integrationsgeschichte.
Ist er nicht, leider, und der Sprachkurs seinerzeit in Lengerich, Westfalen, auch nicht sein Glück gewesen. Eher ein Hindernis. Niemand hat damals in der „Auffangklasse“ für Asylbewerber-Kinder Deutsch gelernt; dazu wurde viel zu viel Russisch und Türkisch gesprochen. Sadinams Aufstieg ist ein (glücklicher!) Betriebsunfall des deutschen Bildungswesens, der heute so nicht vorkommen würde. Seine Mutter hat ihn, obwohl er der deutschen Sprache längst nicht mächtig war, gegen eine dringende Hauptschulempfehlung und erheblichen Widerstand auf die Realschule geredet. Die CDU-Landesregierung Nordrhein-Westfalens, wo Sadinams Geschichte spielt, hat solchem Elterneigenwillen inzwischen einen gesetzlichen Riegel vorgeschoben.
Sadinam hat sich damals schnell auf das Gymnasium hochgedient, ist dort zwei Jahre eingebrochen, weil er sich mehr mit dem wackeligen Aufenthaltsstatus seiner Familie zu beschäftigen hatte als mit Hausaufgaben, aber dann hat er sich dank Zuwanderungsgesetz und guter Lehrer wieder berappeln dürfen. Er hat ein Abi hingelegt, von dem andere nur träumen. Note 1,3.
Mancher hätte es ja gerne anders, gerade jetzt. Nach Roland Kochs aufregenden Schnellschüssen auf gewalttätige ausländische Jugendliche bemüht sich die Kanzlerin, ihre Minister und nicht zuletzt die CDU/CSU, ein bisschen Ordnung in die deutsche Debatte um Integration zu bekommen. Der eher versöhnliche Ruf zum „Fördern und Fordern“ wird wieder in den Vordergrund gerückt. Der (selbstverständlich verpflichtende!) Deutschkurs taucht wieder auf als Allheilmittel, auch und gerade gegen die vorgeblich wachsende Jugendgewalt: Bildung als Integrationsweg. Es wäre schön, wenn man dann so einen Mojtaba Sadinam zum Vorzeigen hätte.
Aber so einfach sind die Dinge leider nicht. Und es geht auch ¬– ganz anders, als derzeit diskutiert – um viel mehr als um das zwar bedauerliche, aber letztendlich nebensächliche Thema der Jugendgewalt. Im Zentrum der Integrationsdebatte steht eine massive Bildungskrise, die nichts weniger als die deutsche Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Die Zahlen sprechen für sich. Fast jeder fünfte Jugendliche mit ausländischem Pass verlässt die Schule ohne Abschluss, unter den Deutschen ist es nur jeder zwölfte. Fast jedes zweite ausländische Kind besucht die Hauptschule, bei den Deutschen ist es nur jedes fünfte. 25 Prozent aller deutschen Schülerinnen und Schüler erreichen ein Abitur, aber nur zehn Prozent der ausländischen Jugendlichen. Nur acht Prozent aller jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund studieren. Deutlich zu wenig.
Es liegt nicht an den Zuwanderern, nicht allein jedenfalls. Dass sie nach der Grundschule fast reflexartig auf Haupt- und Gesamtschulen verschickt werden, haben die beiden internationalen Bildungsstudien Pisa und Iglu schon mehrfach kritisiert. „Die Studien haben ferner gezeigt, dass insbesondere die weiterführenden Schulen nicht in der Lage sind, durch individuelle Förderung etwa die Lesekompetenz der Kinder mit Migrationshintergrund zu steigern – im Gegenteil“, schreibt der Migrationsforscher Ekkehart Schmidt-Fink. Er warnt vor schnellen Schlüssen, weil es vielerorts schwer engagierte Pädagogen gibt, aber er kritisiert doch, dass die generelle pädagogische Praxis im Land vollkommen monokulturell geprägt ist. Kinder mit Migrationshintergrund würden als Abweichung von der Norm, nicht als Chance wahr genommen.
Dabei stammt schon heute jedes dritte Kind unter sechs Jahren aus einer Zuwandererfamilie. In manchen Großstädten sind die Zugereisten in der Überzahl. Wenn Deutschland nicht ein Viertel dieser Kinder auf die Universitäten bekommt, bekommt Deutschlands Wirtschaft ein ernsthaftes Nachwuchsproblem. Und das Land, in dem der Rohstoff Nummer Eins „Vorsprung durch Technik“ heißt, eine Wohlstandskrise.
Gülsah Keles ist zwanzig Jahre alt, ihr Deutsch ist lupenrein. Die junge, selbstbewusste Frau aus Düren im Rheinland hat außer türkischen Eltern auch einen deutschen Pass. Sie bezeichnet sich als gläubige Muslimin und studiert General Management und Wirtschaftssprachen an einer Privat-Uni in Wiesbaden. Auch sie ist Stipendiatin der Vodafone-Stiftung, die begabte Migranten mit Geld, Konferenzen und einem Netzwerk unterstützt. Auch Keles hat es nicht wegen, sondern gegen das deutsche Bildungswesen so weit geschafft. Ihr war die Gesamtschule anempfohlen worden, sie aber drängelte sich ins Gymnasium, um dort dann nach vier Jahren eine Klasse zu überspringen.
Keles hat den Rückhalt einer Familie, in der – anders als in vielen anderen in Düren – auf das Beherrschen des Deutschen ebenso viel Wert gelegt wird wie auf das Beherrschen des Türkischen. In der es – anders als bei vielen ihren Freundinnen – von Anfang an die Option einer Bildungskarriere auch für das Mädchen Gülsah gab. Mit dem Rückhalt der Familie hat sich Gülsah Keles nicht nur gegen die offenbar übliche, instinktive Diskriminierung des Bildungsapparats durchgesetzt – sie ruderte auch gegen den Strom in der eigenen Gemeinschaft. „Viele fanden das hochnäsig, dass ich ans Gymnasium gegangen bin. Ob ich mich für etwas Besseres halte, haben sie gefragt.“
Die junge, attraktive Frau erzählt gerne von einem Schlüsselerlebnis. Von einer Lehrerin, die sie loben wollte vor der ganzen Klasse. Da hatte Gülsah Keles im Deutschunterricht als einzige die Antwort auf eine Frage gewusst. „Seht mal“, kam daraufhin als unvergessliche Ermahnung für die Klassenkameraden von der Lehrerin, „sogar Gülsah weiß das.“ Erst später ist der kleinen Gülsah die Botschaft klar geworden: „Sogar die, die das doch eigentlich gar nicht können kann. Die ist doch Ausländerin, zweite Wahl.“ Für Keles ist daraus ein Leitmotiv erwachsen: „So, jetzt musst Du es denen aber zeigen.“
Der türkischstämmige grüne Europaabgeordnete Cem Özdemir, der zu rot-grünen Zeiten so etwas wie der Vorzeige-Migrant der deutschen Talkshow war, hat das, was Migrantenkinder im deutschen Bildungswesen erleben, einmal als einen 100-Meter-Lauf beschrieben, bei dem die ausländischen Kinder auf der selben Strecke mit den gleichen Schuhen laufen, aber nur ein Bein einsetzen dürfen. Auch sein Vergleich hinkt ein bisschen, doch das Muster ist eins, von dem viele Migranten berichten. Anerkennung bedarf des doppelten Einsatzes, denn man muss immer besser sein als die anderen, um als gleichwertig angesehen zu werden. Der doppelte Einsatz bedarf erheblicher Anstrengung und Selbstdisziplin, denn in vielen Migrantenfamilien fehlt es an akademischer Unterstützung. Und dann fehlt es auch noch an Vorbildern im Privaten und in der Öffentlichkeit, an denen man sich orientieren oder messen kann.
Bile Aden ist zwanzig Jahre alt und lebt in Troisdorf bei Bonn, er hat somalische Eltern und einen deutschen Pass. Dank sehr guter schulischer Leistungen ist er Stipendiat der Hertie-Stiftung, die – ganz ähnlich wie die Robert-Bosch-Stiftung – begabte Migranten schon an der Schule unterstützt. Neben Geld gibt es Kontakte, ein Netzwerk, Veranstaltungen, das Übliche.
Aden, ein etwas steif wirkender und argumentierender junger Mann, will nach dem Zivildienst Medizin studieren. Er hat aber auch schon mit dem Gedanken gespielt, eine politische Karriere einzuschlagen. Warum? Der Einsatz für das Gemeinwesen ist ihm wichtig. Gern würde er sich zudem als Vorbild sehen für andere Migranten. Mit der Frage, wie er zu Deutschland steht, muss er länger ringen. Er hat rassistische Übergriffe erleben müssen, will darüber aber nicht reden. Er sei somalischer Deutscher, sagt er schließlich.
Die Frage der Identität ist nicht nur für ihn ein heikles Thema. Zwischen Identität und Integration gibt es eine Wechselbeziehung. In den USA zählen arabische Amerikaner zu den wirtschaftlich und im sozialen Aufstieg erfolgreichsten ethnischen Gruppen – und sie identifizieren sich instinktiv und voll und ganz mit Amerika, das ihnen diese Identifikation auch erlaubt. Die arabischen Einwanderer in Frankreich sind dagegen besonders erfolglos – und sehen sich so wenig als Franzosen wie die Franzosen sie als ihresgleichen sehen.
Zarine Karapetyan ist 19 Jahre alt. Sie ist in Dresden geboren, aber ihre Eltern kommen aus Armenien, aus Jeriwan. Sie ist eine gute Schülerin. Sie macht demnächst ihr Abitur in Sachsen – und sie ist, aufgrund guter Leistungen, eine Stipendiatin der Hertie-Stiftung. „Meine schulische Laufbahn“, sagt Karapetyan, „ist gut verlaufen. Negative Erfahrungen habe ich keine gesammelt. “ Die junge Frau möchte ganz bestimmt nicht schlecht über ihre Umwelt reden. Ganz im Gegenteil. Es komme nicht so sehr darauf an, „ob Deutschland mit offenen Armen auf uns zu kommt“, sagt sie, „sondern darauf, dass Ausländer sich der Integration öffnen.“ Das hört man gerne. „Ich habe mich nie diskriminiert, nie schlecht behandelt gefühlt, bin immer gerne zur Schule gegangen“, sagt die junge Frau. Auch Ausnahmen muss es eben geben.
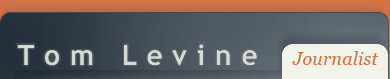
 Themenschwerpunkte
Themenschwerpunkte Artikelliste
Artikelliste