23. April 2006 | Welt am Sonntag
Die wahren Helden
Seit kurzem wird in Deutschland heftig darüber debattiert, warum so wenige Kinder geboren werden. Es geht um Rente, Bevölkerungsentwicklung, Sozialsysteme. Um Eltern geht es selten. Was sind ihre Sorgen und Nöte? Warum haben sie Kinder bekommen? Wir haben vier Paare mit Kindern besucht, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen.
Deutschland, München, Gräfelfing, ein helles Wohnzimmer in einer Mehrfamilienvilla. Die Welt geht gerade unter. Claras Welt zumindest. Die Vierjährige will von ihrer Schwester Luise das kleine weiße Spielzeugauto zurückhaben, das sie jener vorhin - in einem Anflug übereilter Großzügigkeit - zum Geschenk gemacht hat. Luise, zwei Jahre alt, will von Rückgabe naturgemäß nichts wissen. Ergo läßt Clara ihrer Wut freien Lauf und der glockenhellen Stimme dazu: "Ich will mein Auto zurück." Im Nu hat sich die gemütliche Wohnstatt der Familie Müllauer in eine Nervenkampfzone gewandelt. Neben der kleinen Sofie, ein Jahr alt und jetzt gerade vergleichsweise ruhig, gehören heute abend Mutter Sabine und Vater Bernhard zu den Kollateralgeschädigten. Die Unternehmensberaterin und der Allgemeinmediziner haben jeweils einen Tag in der Arbeitswelt hinter sich; die Geduldsfäden sind von begrenzter Länge. Auf ihren Gesichtern macht sich entsprechend Anspannung breit. Aber es hilft ja nichts: Vor dem Familienfeierabend steht jetzt eine Weltrettung an.
Ein echter Heldeneinsatz also. Bestseller-Autor Frank Schirrmacher müßte also ein bißchen begeistert sein. Denn er hält Menschen, die heute noch Kinder bekommen, für altruistisch. Selbstlos also. Das hat er in seinen Buch "Minimum" aufgeschrieben, das die aktuelle Debatte um demographische Entwicklung, Kindermangel und -feindlichkeit mit ausgelöst hat.
Familienmenschen, vor allem aber die Mütter der Nation sind für Schirrmacher die Helden, die die Gesellschaft retten müssen. Um deren Überlegenheit gegenüber Singles und Kinderlosen zu beweisen, hat er sich tief in die Geschichte menschlicher Katastrophen eingelesen. Er hat die "Tragödie am Donner-Pass" von 1846 ausgegraben und den nicht minder vergessenen Brand des Vergnügungszentrums Summerland auf der Isle of Man von 1973. Hier wie da waren Familienbande nützlich und lebensrettend. Aus diesen historischen Erfahrungen zieht Schirrmacher Schlußfolgerungen für die Gegenwart: Familien sind etwas ganz Besonderes. "Mit Heldentum hat Familienleben allerdings nichts zu tun", sagt Bernhard Müllauer. "Es ist auch nicht altruistisch, Kinder zu haben." Er sitzt, als die Weltrettung dank geldwerter Ersatzleistung (ein Püppchen aus dem Präsent-Fundus der Eltern) gelungen ist, wieder ganz entspannt auf dem Sofa. Kinder bekäme man, weil man für sich selbst Kinder haben wolle, sagt der junge Mediziner. "Für uns war ein Motiv, daß wir später nicht allein sein wollten."
Sabine Müllauer ist nicht ganz so sicher. "Wir haben das alles schon mal so oder so gesehen", sagt sie. Die studierte Medizinerin erzählt vom täglichen Kampf am Rande des Nervenzusammenbruchs: Frühmorgens erst sich selbst, dann die Kinder fertig machen, Frühstück, Schuhe und Jacken an ("und dann spuckt Sofie mich voll, und ich kann mich noch mal völlig umziehen"), das Ganze dann einpacken und in den Kindergarten bringen ("aber leider geht das Auto einfach nicht auf"), verspätet bei der Krabbelgruppe sein, verspätet bei der S-Bahn - "und dann spricht mich da eine wildfremde Frau an: ,Ganz unter uns, Sie haben da eine riesige Laufmasche."" Jetzt kann sie drüber lachen. An jenem Morgen nicht.
"Manchmal glaube ich, daß man etwas Heldenhaftes braucht, um sich mit drei kleinen Töchtern in der Umwelt durchzusetzen", sagt sie. Da sind diese Blicke, wenn man mit den Kindern in die S-Bahn steigt. Der Stress mit Nachbarn. Blöde Bemerkungen. Die Gedankenlosigkeit mancher Bekannten. Das Desinteresse des Arbeitgebers. Es ist die Umwelt, die den Familien zusetzt, meint Sabine Müllauer; der Alltag ist einfach Alltag.
Deutschland, schrieb im vergangenen Jahr die von der Robert-Bosch-Stiftung ins Leben gerufene Kommission "Familie und demographischer Wandel" in einen klugen Bericht, Deutschland ist kinderentwöhnt. "Familien wachsen, wo die persönliche und gesellschaftliche Umgebung Familien und Kindern mit Wertschätzung begegnet", heißt es. Neben den ökonomischen, finanziellen, rechtlichen Rahmenbedingungen, die für Familien herrschen, müsse sich vor allem das gesellschaftliche Klima in Deutschland ändern. Die derzeitige Debatte über die Härten des Familienlebens ist dabei, so kürzlich Cathrin Kalweit in der "Süddeutschen Zeitung", gar nicht hilfreich. "In der politischen Debatte wie auch in medialen Parallelwelten erscheint das Leben mit Kindern als anstrengende Anomalie", schreibt die Journalistin, "der sich nur stellt, wer unbelehrbar ist."
Regine Zylka, Co-Autorin von "Das große Jein", einem Gegenbuch zu Schirrmachers "Minimum", fordert den Perspektivwechsel. "Wenn man sich der Wirklichkeit stellt, dann wird man viele kleine Dinge finden, die man verändern kann, um Familien wirklich zu helfen." Deutschland, Ratingen bei Düsseldorf, Lintorf, die Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses am Rande der Stadt. Robert und Christiane Hentschke finden ihre Wahlheimat eigentlich entspannend kinderfreundlich. "Wenn wir einkaufen gehen", erzählt die Mutter von Elli, 4, und Paul, 8, "dann kriegen die Kinder überall etwas zugesteckt: Möhren, Bananen, Äpfel." Die Ratinger freuten sich über den Nachwuchs. Beim Wohnungssuchen habe ein Vermieter darauf Wert gelegt, daß Kinder einziehen.
Es ist das System, das die Hentschkes irritiert hat. In Lintorf zum Beispiel wurde lange der Bedarf an Kindergartenplätzen ignoriert. Als Paul einen brauchte, gab es 90 Plätze zuwenig. Eltern mußten erst eine Initiative gründen, bevor sich etwas tat. Robert Hentschke, Milchwirt von Beruf, sieht darin einen Ausdruck tieferer Mißverhältnisse: "Wenn man ein Gebäude bauen will und man plant nicht genug Auto-Stellplätze ein, dann gibt es richtig Ärger. Aber niemand scheint sich dafür zu interessieren, ob es Spielplätze gibt."
Dabei hatten die Hentschkes es noch sozusagen gut, weil die lokale Betreuungskrise nicht berufsbedrohend wirkte. Christiane Hentschke hat ihren Job aufgegeben, als Elli unterwegs war. Sie fand das damals richtig so und hat es bis heute nicht bereut. Sie findet es ärgerlich, daß sie sich häufig dafür rechtfertigen muß, warum sie nicht mehr arbeitet (so wie es Sabine Müllauer ärgert, daß sie das Gegenteil erklären soll). Ihre Kinder stellten keine Einschränkung ihres Lebens dar, sagt Christiane Hentschke, ganz im Gegenteil. Sie habe auch nicht ihre Identität aufgegeben oder ihre Freiheiten, wie es heute überall heißt. "Wir gehören vielleicht einem prähistorischen Wertesystem an", lacht sie. Aber für sie und ihren Mann sei das Kinderhaben eine Selbstverständlichkeit gewesen. Daß die Debatte verrutscht erscheint, ist nicht allein ihr Eindruck. Das Gezerre ums Elterngeld, das derzeit die Union zerreißt, ist in den Familien noch gar nicht angekommen. Die große Diskussion um die Gewinn-und-Verlust-Rechnung des Kinderkriegens ist eine Debatte der Kinderlosen. Vor zwei Jahren hat Allensbach herausgefragt, daß über die Hälfte der Nichteingeweihten die finanziellen Nachteile fürchtet, die ein Kind mit sich bringt. Die Zeitarbeitsagentur Randstad hat herausgefunden, daß die Kinderlosen die Schwierigkeiten überschätzen. Die Biedenkopf-Kommission schreibt, daß die finanziellen Möglichkeiten, sich für Kinder zu entscheiden, im Vergleich zu den Sechzigern nicht schlechter, sondern wesentlich besser geworden sind. Was sich geändert hat in der Gesellschaft, das sind Einstellungen und die Zahl der Optionen, das Leben anders zu gestalten. Das hat den Druck auf alle erhöht: Man kann nicht nur, man muß sich heutzutage entscheiden.
Deutschland, Hamburg, Sasel, ein Einfamilienhaus mit Garten. Susanne Schlösser sitzt in ihrem Wohnzimmer. Ihre beiden Kinder Fabian und Kim-Aileen sind 16 und 13 Jahre alt. Zwölf Jahre davon hat die Mutter sie allein großgezogen. Den Vater der beiden hat sie vor die Tür gesetzt, als Kim ein paar Monate alt war. "Er hat nicht die Kurve bekommen", sagt sie: "Spielsucht". Sie hat ihre Tochter damals im vollen Bewußtsein des Risikos auf die Welt gebracht, daß die Ehe an der Sucht zerbrechen kann. "Aber ich wollte nie ein Einzelkind." Sie sagt das ganz entschieden.
Sie hat bezahlt; der Ex dagegen nie. Um die Familie durchzubringen, hat Susanne Schlösser halbtags am Schalter der Sparkasse gesessen. Sie hat auf Karriere verzichtet ("das wollte ich nicht, wenn meine Kinder darunter leiden würden") und auf manchen Urlaub, manches Kaffeekränzchen, jeden Luxus. Ihre Eltern haben sehr geholfen, "und es gab Freundinnen, die am Samstag schon mal einen kompletten Einkauf in Tüten vor die Tür gestellt haben, ohne zu klingeln, weil sie wußten, daß ich das nicht annehmen würde", erzählt Susanne Schlösser. Solche Unterstützung, selbstlos und erwartungsfrei, ist aber die Ausnahme gewesen. Sie habe eher das Gefühl gehabt, daß die Dinge schwieriger werden. "Deutschland ist schon ein sehr kinderfeindliches Land", sagt sie. Es gebe nur wenige Leute, die Hilfe anbieten. Wenige, die mitdenken. "Es wäre manchmal ganz einfach." Sie hat es allein geschafft, "und manchmal klopfe ich mir heimlich dafür auf die Schulter". Sie ist stolz auf ihre Kinder. Sie ist an der Aufgabe gewachsen. Susanne Schlösser ist eine sehr starke Frau. Für manchen eine Heldin gar.
Stolz ist sie auch darauf, daß sie ihren zweiten Mann gewonnen hat. Vor zwei Jahren war Sven Schlösser noch ein echter Single, mit all den Frei- und Leerräumen, die ein solches Leben mit sich bringt. Er hat sich lange und schwer überlegt, gibt er zu, ob er das machen soll: die Beziehung zu seiner Freundin zu vertiefen und sich damit zwei Kinder ins Leben zu holen. "Es gab mich nicht solo", erinnert sich Susanne Schlösser, "es gab mich nur mit Anhang." Sven Schlösser hat dann ja gesagt, "es hat einfach gepaßt". Seine Frau sagt: "Ich erkenne ihm das hoch an, so einen gewaltigen Schritt getan zu haben." Es sei eben Glückssache gewesen.
Vielleicht liegt es ja in der Natur der Sache Familie. Allensbach hat im Sommer 2004 für das Forum "Familie stark machen" ermittelt, daß Familien meistens glücklich sind, vor allem dort, wo es noch ganz, ganz kleine Kinder gibt. Familienbande seien heute aber längst keine Garantie mehr, das Glück zu finden, schränken die Demoskopen ein. Die Glücksforschung ist sich ähnlich unsicher. "Kinder machen unglücklich", behauptet etwa der Münchner Glücks-Experte Bernd Hornung, "schon weil sie Arbeit, Stress und Enttäuschung bedeuten." In den USA gebe es Studien, die belegten, daß das Eheglück mit der Zahl der Kinder abnehme. Andere Wissenschaftler sehen das ganz anders. "Kinder sorgen für Sinn im Leben, der auf andere Weise nicht so ohne weiteres zu haben ist", sagt der Berliner Philosoph Wilhelm Schmid. "Deswegen nehmen Menschen Nachteile, auch finanzieller Art, in Kauf."
Deutschland, Oldenburg, Bümmerstede, eine kleine Küche in einer kleinen Dachwohnung. Peter Schneider ist ein unglücklicher Mensch. Er ist 42 Jahre alt und beschreibt ein Leben, das eigentlich nur aus Nachteilen besteht. Er hat Jasmin, 4 Jahre alt, und Pascal, 10, in seine Beziehung mit Sylvia Krause, 33, eingebracht, sie dafür Julian, 12, und Tanita, 13. Als Patchwork-Familie versuchen sie das Überleben. Es ist jeden Tag ein Kampf.
Peter Schneider war mal Unternehmer. Heute lebt er von Arbeitslosengeld II, Hartz IV. Weil Sylvia Krause Architektur an der Fachhochschule studiert, bekommt sie nichts vom Arbeitsamt. Weil sie mal gearbeitet hat und zu alt ist, bekommt sie aber auch kein BAföG. Man hat ihr geraten, das Studium aufzugeben, um wieder anspruchsberechtigt zu sein. "Aber ich will das durchziehen. Ich will meinen Kindern eine Ausbildung finanzieren können", sagt sie.
Ihr Leben bestimmt Hartz VI. Jede Kleinigkeit ist ein Verwaltungsakt. Peter Schneider hat den Aktenordner immer griffbereit: Sein Alltag sind Bescheide, Einsprüche, Beschwerden, die "Arge", wie das Arbeitsamt jetzt heißt. Manchmal seien die Probleme, sagt Sylvia Krause, kaum noch auszuhalten. Ihr Glück sind die Kinder. "Wenn die nicht trotz alledem so fröhlich wären, uns psychisch aufbauen, dann wäre alles viel schlimmer."
Die Familie will umziehen, weil es in der Wohnung zu eng ist für sechs Personen. Die neue Wohnung hat das Amt erst genehmigt, jetzt scheint sie ihm zu groß. 605 Euro bekommt die Familie für die neue Küche und vier Kinderbetten. "Ich weiß nicht, wie das gehen soll", sagt Peter Schneider. Seine kleine Tochter Jasmin sitzt mit am Tisch an diesem Morgen. Sie legt ein Puzzle. "Ich will den Papa heiraten", sagt sie. Sie gibt ihm einen Kuß. Peter Schneider lächelt. Er ist ihr Held.
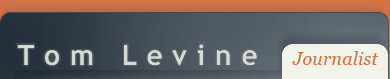
 Themenschwerpunkte
Themenschwerpunkte Artikelliste
Artikelliste